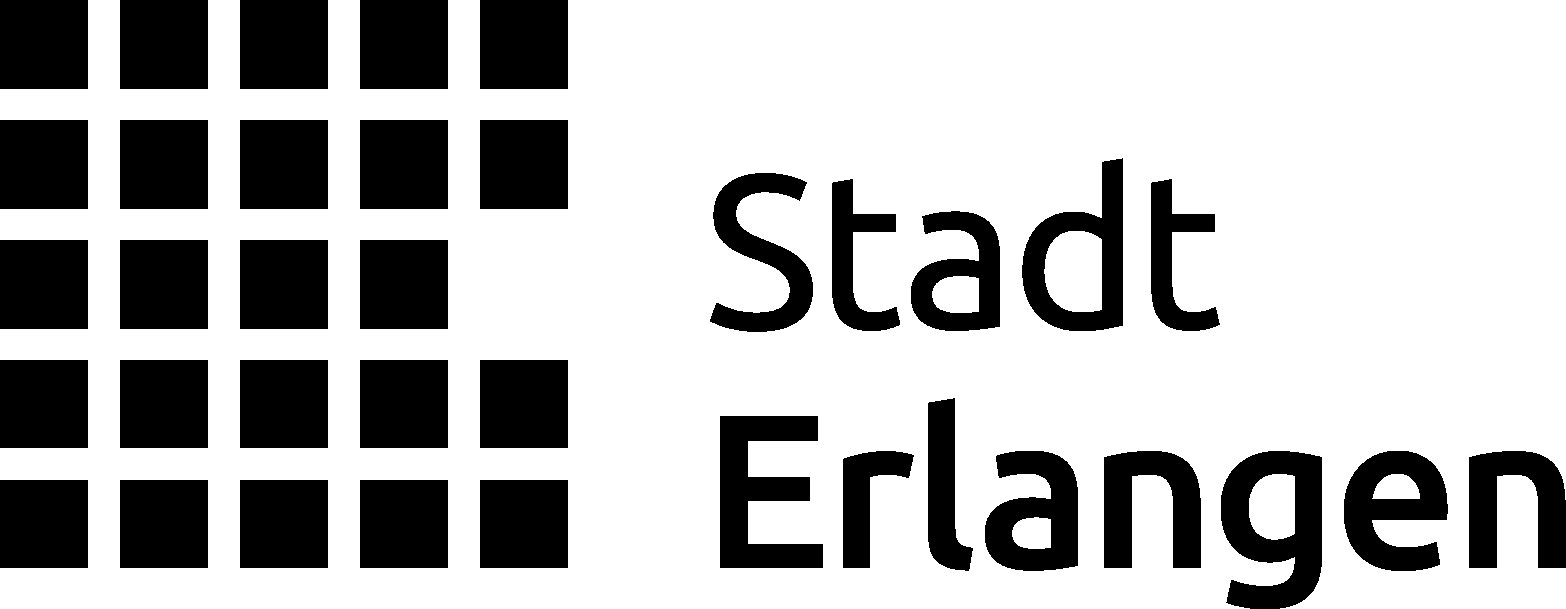Am 11. April startete unsere diesjährige Vortragsreihe mit Prof. Dr. Michael Lackner im Bildungszentrum der Stadt Nürnberg.
"Formeln für China" gibt es viele, denn so alt wie die Kontakte zwischen dem Westen und China sind auch die zahlreichen Versuche westlicher Denker, China "auf einen Nenner" zu bringen. Der Vortrag beleuchtet diese Ansätze, die ebenso unterschiedlich sind wie die Ausgangspunkte ihrer Urheber. Es gibt viele Deutungen und eine jede von ihnen kann durchaus gewichtige Gründe für den oder die Nenner anführen, auf den/die sie die chinesische Zivilisation bringen will.
So findet man die sogenannten "master narratives", die in endgültiger und vor allem verbindlicher Weise Geschichte und Kultur deuten sollen. Nicht alle bringen in derart verführerisch bestechender Weise die Kultur Chinas auf einen Punkt wie die des Ethnologen André-Georges Haudrícourt (1911-1996). „Sie sind aber alle dadurch charakterisiert, dass sie nur einen einzigen gemeinsamen Nenner zeitigen, der uns die Rätsel Chinas gesamt in griffiger Weise deuten soll“, erklärt Lackner.
Erzählungen in der Geschichtswissenschaft
"Meistererzählungen, die längst Eingang in die Geschichtswissenschaft gefunden haben, wollen uns glauben machen, Geschichte sei auf diese Weise darstellbar", so der Professor. Poststrukturalisten wie Jean-François Lyotard oder Dekonstruktivisten wie Hayden V. White verweisen jedoch auf den subjektiven Charakter des Erzählerischen. Unter den Autoren, die Lackner ohne Anspruch auf Vollständigkeit vorstellt, sind Sinologen, also Personen, die sich mit der Sprache und Kultur Chinas gewissermaßen hauptamtlich beschäftigt haben, aber auch Gelehrte, die an Geschichte, Gesellschaft und Religion interessiert waren bzw. sind.
Aussagekräftiger als etwa Marco Polo zeigt sich der erste systematische abendländische Entwurf der chinesischen Kultur von Jesuitenmissionaren, die ab 1583 in China Fuß fassten. Sie haben das europäische Chinabild bis Mitte des 18. Jahrhunderts entscheidend bestimmt mit zentralen Meistererzählungen über China. Ausgangspunkt dieses Kulturvergleichs war Gemeinsamkeit, nicht Differenz.
Das Jahrhundert danach, von etwa 1650 bis 1750, war in Europa geprägt durch das Vertrauen in die chinesische Vernunft, die es zu imitieren galt, ob im Bereich der Wirtschaft oder dem der Religion, hier besonders der religiösen Toleranz. Als man sich allerdings vom aufgeklärten Absolutismus abzukehren begann, fand gleichzeitig eine Abwendung von China statt.
So sah der Dichter und Philosoph Johann Gottfried Herder in China gar eine zu allem Großen völlig unfähige "mongolische Rasse". Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Vertreter des deutschen Idealismus, schlug in dieselbe Kerbe. Im weiteren Verlauf des 19. Jahrhunderts gab es außerdem noch weit weniger von Fakten gespeiste Meistererzählungen.
Professor Dr. Michael Lackner möchte vor allem mit dem vielleicht einzigen Sinologen englischer Sprache bekannt machen, der im 19. Jahrhundert sozusagen einen großen Wurf wagte, obwohl er in China lebte: mit Thomas Taylor Meadows. Er veröffentlichte 1856 sein Werk "The Chinese and their Rebellion", das vordergründig vom gerade ausgebrochenen Taiping-Aufstand handelt, in Wirklichkeit jedoch eine philosophische Interpretation des chinesischen Reiches und seines damaligen Niederganges darstellt. Eine spannende Geschichte!
Ansätze aus einer Perspektive
Während der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert gewann die Vorstellung vom "primitiven Denken" Gestalt. Zahlreiche Ansätze der Betrachtung Chinas und der Sinologie wurden aus einer Perspektive erklärt, die China ein oder mehrere Defizite zusprach. Bahnbrechend dürfte hier der deutsche Soziologe, Jurist, National- und Sozialökonom Max Weber (1864-1920) gewesen sein.
Kritik des ehemaligen Marxisten Karl Wittfogel (1896-1988) an der Macht Chinas im 20. Jahrhundert oder die "Fundamentale Liebe zur Weisheit Chinas", wie man das Chinabild des Sinologen Richard Wilhelm nennen könnte, zeigen sehr gegensätzliche Standpunkte. Wilhelm hatte dabei wohl "zwei Seelen in seiner Brust". Während er in Deutschland einen eher kulturkonservativen Eindruck Chinas zu vermitteln suchte, vereinte er während seiner Zeit in Peking die revolutionärsten Köpfe Chinas zu Diskussionsrunden und Mitarbeit an seiner Zeitschrift.
Dann ändert sich die Sichtweise wieder. In seinem 1998 erschienenen Buch "The Chan’s Great Continent. China in Western Minds" stellt der US-amerikanische Sinologe Jonathan Spence ein ganz eigenwilliges Panorama abendländischer Vorstellungen zu China dar. Spence kümmerte sich nicht um die Frage der "master narratives", er entwarf vielmehr ein buntes Bild von Epochen, national und anders definierten Betrachtergruppen (Frauen, Reisende). In seinem gesamten Werk findet sich die Verdichtung zum Bild eines bald verführerisch, bald bedrohlich anderen Chinas.
Sieht man sich all diese Deutungen an, bleibt, dass "niemals der Anspruch des ‚master narrative‘ eingelöst werden kann, eine Formel schlechthin gefunden zu haben", betont Professor Lackner. Im Anschluss an den Vortrag blieb noch genügend Zeit für viele Fragen aus dem zahlreich erschienenen Publikum.